Don Draper und die Identitätsfrage
- fowlersbay

- 24. Aug. 2025
- 4 Min. Lesezeit
Aktualisiert: 25. Aug. 2025
Ständig läuft im Fernsehen eine Quizshow oder mittelmäßige Krimiserie. Dabei sieht der Rundfunkstaatsvertrag vor, die „kulturellen Bedürfnisse der Gesellschaft zu erfüllen“. Während der üblichen Fernsehzeiten ist davon wenig zu merken.
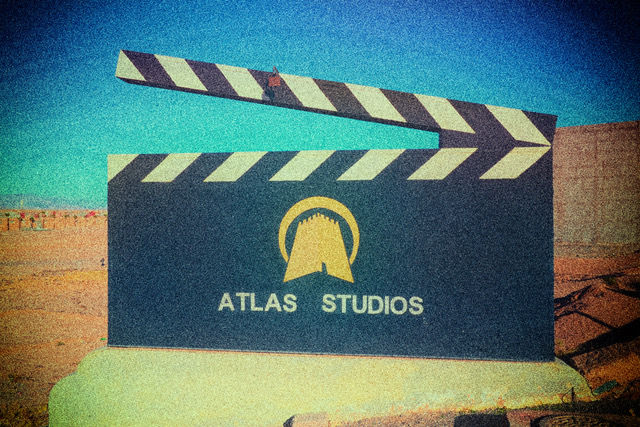
Wohl dem, der über eine gut sortierte DVD-Sammlung verfügt. Vor allem amerikanische Qualitäts-Serien wie „Mad Men“ zeichnen sich durch philosophische Tiefe aus.
Worum geht es?
Auf den ersten Blick, um die schillernde Werbewelt im New York der 60er und 70er Jahre.
Die Mad Men (abgeleitet von Ad Men/Werbeleute) kleiden alltägliche Konsumgüter in unwiderstehliche Slogans. Ihrem Selbstverständnis entsprechend, vermarkten sie nicht schnöde Alltagsprodukte… sie erzeugen Glücksgefühle.
Während der Arbeit wird geraucht und getrunken, als gäbe kein nächstes Meeting… darüber hinaus sexistische Kommentare. Das ist aus heutiger Sicht schwer erträglich, aber ein treffendes Bild der damaligen Arbeitswelt.
Alles so kaputt hier!
Im Kern geht es bei „Mad Men“ um die Verfasstheit der Protagonisten. Fast alle sind auf mannigfaltige Weise emotional angeschlagen. Sex, Alkohol und die Sucht nach beruflichem Erfolg halten die Maschinerie am Laufen.
Im Zentrum dieser illustren Runde befindet sich Don Draper, der genialische, smarte, arrogant und zugleich verloren wirkende Star-Werber der Agentur. Formvollendet lebt er den amerikanischen Traum der frühen 60er Jahre: schöne (Haus-)Frau, entzückende Kinder, repräsentatives Haus, schnelle Autos und Affären.
Allerdings fällt es ihm immer schwerer, den geheimsten und prägendsten Moment seines Lebens auszublenden. Der dunkle Fleck frisst ihn innerlich auf. Schon im Vorspann der ersten Folge stürzt eine, ihm ähnliche, Figur vom Dach eines Wolkenkratzers und nimmt vorweg, dass Don Draper, ganz oben angekommen, der Absturz bevorsteht.
Wer bin Ich? So genau weiß das Don Draper, der eigentlich Dick Whitman heißt, selbst nicht. Er spürt nur eine Leere und Verlassenheit, die auf einem Jahre zurückliegenden Identitätsdiebstahl beruht. Um vorzeitig den Kriegsdienst quittieren zu können, nimmt er die Identität eines getöteten Kameraden (des echten Don Draper) an.
Identität – was ist das?
Philosophisch betrachtet, geht es um die Frage, was die Identität eines Menschen ausmacht. Für John Locke (1632-1704) ist die Identität eines Menschen durch die Kontinuität seines lebendigen Körpers bestimmt. Demnach wäre Don Draper noch immer derselbe. Aber:
„Das Problem der personalen Identität durch die Zeit besteht darin, die notwendigen und hinreichenden Bedingungen anzugeben, unter denen eine Person, die zu einem Zeitpunkt identifiziert wurde, identisch ist mit einer Person, die zu einem anderen Zeitpunkt identifiziert wurde.“ (Brüntrup u. Gillitzer)
Für Godehard Brüntrup und Berthold Gillitzer existieren drei grundlegende Kriterien zur Bestimmung der Identität:
Körperliches Kriterium
Psychologisches Kriterium
Einfaches Kriterium
Für diesen Beitrag sind die ersten beiden von Bedeutung.
Das körperliche Kriterium
Gemäß (1) ist eine Person P2 zum Zeitpunkt t2 mit der Person P1 zum Zeitpunkt t1 identisch, wenn beide denselben Körper haben. Was passiert im Fall einer Beinamputation? Die personale Identität betreffend, nicht viel, denn die meisten Forscher gehen davon aus, dass das Gehirn das identitätsstiftende Körperteil darstellt. Ein verlorenes Bein mag das Selbstwertgefühl und die körperliche Leistungsfähigkeit dramatisch beeinflussen. An der Identität des Menschen ändert sich dadurch nichts.
Sollten in ferner Zukunft Gehirntransplantationen möglich sein, würde die „Person“ (die Identität) dem Gehirn in einen neuen Körper folgen. So zumindest die weit verbreitete Annahme.
Dem körperlichen Kriterium zufolge wäre Don Draper trotz seinen Namens- und Identitätswechsel noch immer derselbe. Seine körperliche Kontinuität ist gewahrt, das Gehirn noch immer mit dem gleichen Körper verbunden.
Das psychologische Kriterium
In diesem Fall garantieren die Kontinuität und Verbundenheit mentaler Zustände (z. B. Erinnerungen) die personale Identität.
Eine Person P2 ist zum Zeitpunkt t2 mit der Person P1 zum Zeitpunkt t1 identisch, wenn P2 zum Zeitpunkt t2 durch eine kontinuierliche Kette von Erinnerungen mit Person P1 zum Zeitpunkt t1 verbunden ist.
„Gefordert ist nicht eine aktuelle Erinnerung der gesamten Vergangenheit, sondern eine Kette von sich überlappenden Erinnerungen.“ (Brüntrup, Gillitzer)
Was ist damit gemeint? Man erinnert sich in diesem Moment an Ereignisse im vergangenen Jahr, im vergangenen Jahr erinnerte man sich an Ereignisse im Jahr davor usw.
Gemäß dem psychologischen Kriterium bleibt die Identität von Dick Whitman (Don Drapers richtiger Name) trotz der Aneignung des fremden Lebenslaufes gewahrt.

Was ist dann das Problem?
Don Draper hat eine Vergangenheit als Dick Whitman… die er verschweigt. Zudem eine Vergangenheit (und Gegenwart) als Don Draper… die auf einer Lüge beruht.
Diese Identitätsdiffusion ist die Quelle seines Leidens. Er ist dazu verdammt, die Rolle des Don Draper konsequent weiterzuspielen. Zu viel steht auf dem Spiel: seine Ehe, seine Karriere. Kurzum, seine gesamte bürgerliche Existenz. Wobei die ohnehin brüchig zu werden droht.
Die intensivsten Momente sind diejenigen, in denen Don Draper versucht, trotz seiner inneren Kämpfe eine integre Person zu sein und zwischen den beiden Identitäten zu balancieren. Sein erratisches Agieren, die Gemütsschwankungen und die (vergebliche) Sehnsucht nach tief empfundener Liebe sind Ausdruck dieses Ringens.
„Unter ‘Integrität‘ sollte man nicht einfach sture Enthaltsamkeit oder rigide Moraltreue verstehen, sondern den echten Versuch, ein Leben zu führen, in dem man sich selbst und seinen Werten treu zu bleiben versucht.“ (Susanne Schmetkamp).
Die Autorin ist der Ansicht, dass kaum ein philosophischer Text dieses Thema derart gut und reichhaltig erfahrbar machen kann. Hinzu kommt die spezifische Stärke des Serienformats: episch angelegt, gibt es den Protagonisten Zeit für persönliche Entwicklungen. Das geht so weit, dass „der Zuschauer seine Geschichte mit der Serie hat“ (Schmetkamp).
Am Ende sehen wir Don, den kalifornischen Pazifik im Hintergrund, in einer Gruppe meditieren. Dann, als finale Szene, der Übergang in einen real existierenden Coca-Cola-Werbespot.
Für welche Identität hat er sich entschieden? Wir erfahren es nicht. Das Ende bleibt bewusst und auf sehr intelligente Weise offen. Vielleicht hat er in dem Retreat sein wahres Ich gefunden und der Spot ist lediglich eine Erinnerung an seine Zeit in New York. Es kann aber auch sein, dass ihm in diesem Umfeld die Inspiration dazu gekommen ist.
Literatur
Brüntrup, Godehard u. Gillitzer, Berthold: Der Streit um die Person, Information Philosophie (4)1197, 18-27.
Schmetkamp, Susanne: Wer immer strebend sich bemüht…, SRF, in: https://www.srf.ch/kultur/film-serien/tv-serien-kult-und-kultur-wer-immer-strebend-sich-bemueht (abgerufen am 24.08.2025).






Kommentare